
Das graue Lied Warum wird mir so dumpf und düster doch, So matt und trüb um die beengte Seele, Wenn ich an einem grauen Nachmittag An meinen Büchern mich vergeblich quäle, – Wenn wie ein aschenfarbiges Gewand Der Himmel hängt ob den verschlafnen Auen Und weit und breit von dem geliebten Blau Nicht eine Spur das Auge kann erschauen? Ein Geiglein tönt aus einem fernen Haus, Man hört es kaum, gefühlvoll thät' es gerne, Gezognem Weinen eines Kindes gleich Mit dünnem Klang langweilig in die Ferne. Kein Lüftchen geht, kein Grün bedeckt die Flur, Der Lenz ist da, doch will's ihm nicht gelingen, Die alten Streifen winterlichen Schnee's In Wald und Graben endlich zu bezwingen. So öd und still! Das schwarze Vöglein nur, Das frierend sitzt auf jenes Daches Fahnen, Zieht langgedehnten traur'gen Laut hervor, Als wollt' es an ein nahes Unglück mahnen. Ich weiß es wohl, solch grauer Nachmittag Ist all mein Wesen, all mein Thun und Treiben. Nicht Wehmuth ist's, nicht Schmerz und auch nicht Lust, Das Wort spricht's nicht, die Feder kann's nicht schreiben. Mir ist, als war' ich selber Grau in Grau, Zu viel der Farbe scheint mir selbst das Klagen, Ob Leben Nichts, ob Leben Etwas ist, Wie sehr ich sinne, weiß ich nicht zu sagen. Friedrich Theodor Vicher
Friedrich Theodor Vicher (1807 – 1887), deutscher Philosoph, Dichter, Schriftsteller
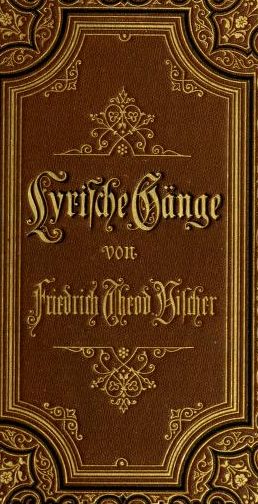
aus: „Lyrische Gänge“ von Friedrich Theodor Vicher. Verlag: Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1882. Jugendjahre, Seite 7 – 8

